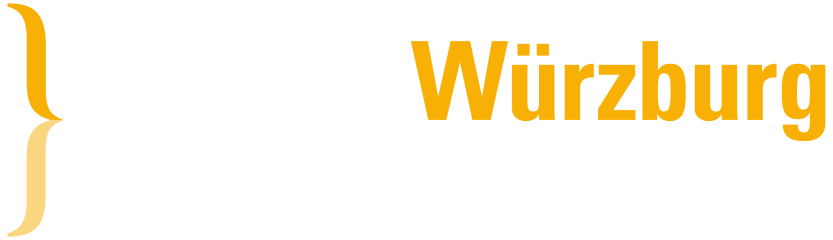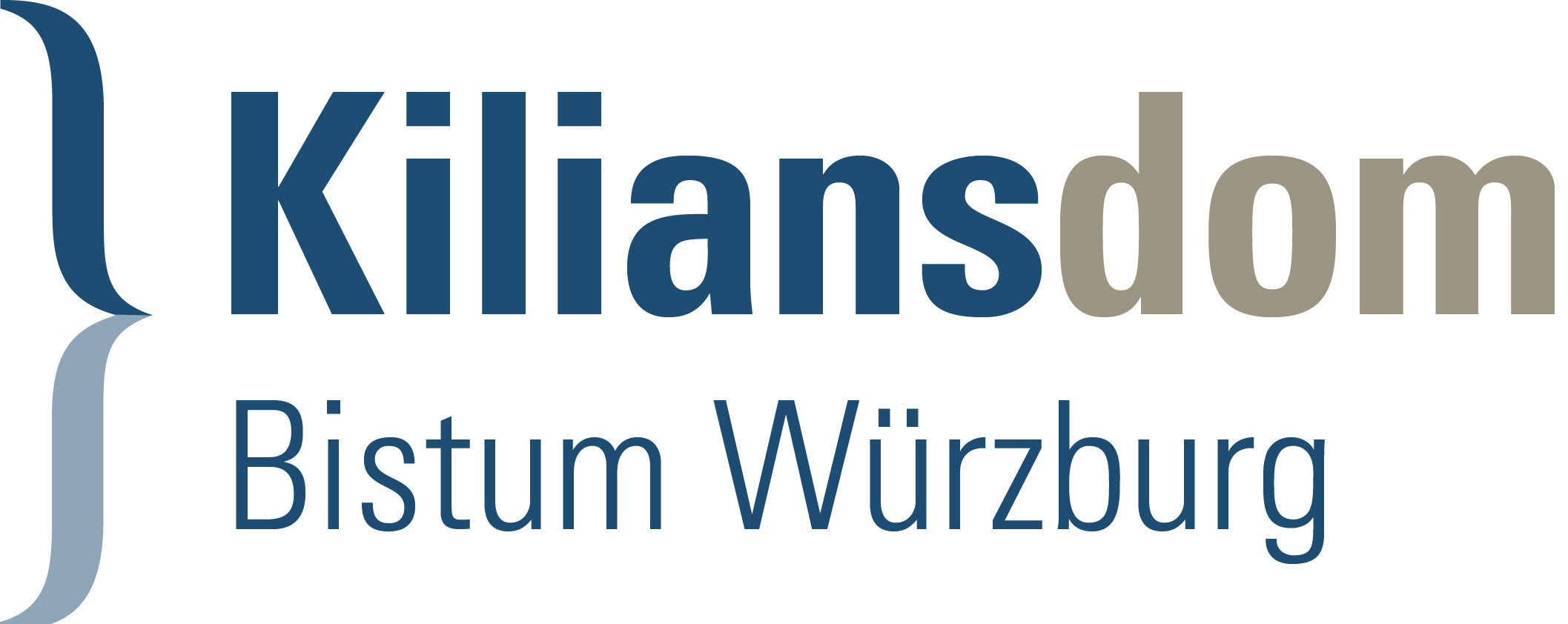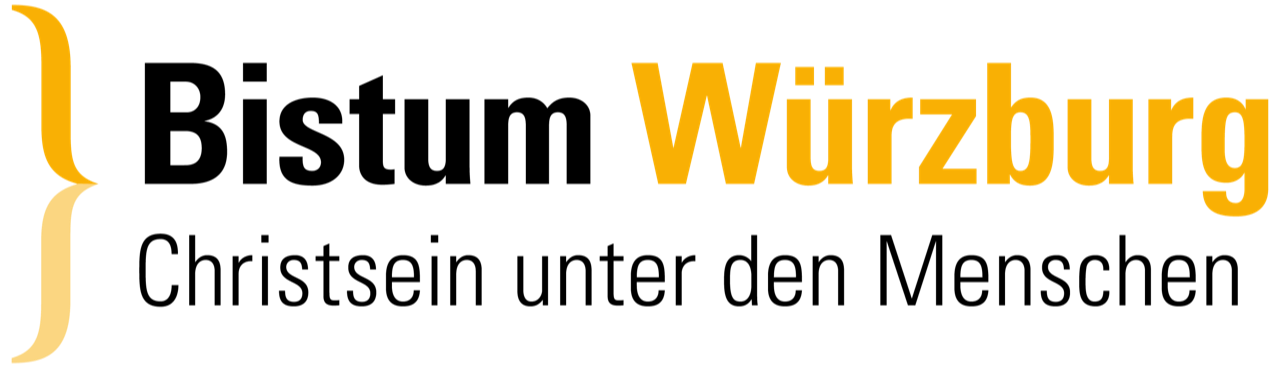Liebe Schwestern und Brüder!
Ich habe in der vergangenen Fastenzeit wieder einmal den Roman mit dem Titel „Der gottlose Pfarrer“ gelesen. Beim Büchereinstellen fiel er mir wieder auf. In diesem Roman wird die Geschichte von einem Pfarrer Hausner erzählt. Seit 27 Jahren ist er Pfarrer einer Gemeinde, als das Undenkbare passiert. Am Ostersonntag, mitten im Festgottesdienst, mitten in der Predigt, mitten im Satz verliert er seinen Glauben. Seine Rede stockt, sie brach ab: er stellte fest, er hat seinen Glauben verloren. Die Gemeinde ist ratlos, ein Schock, ein Skandal. Später dann: Die Kirchenleitung versucht, ihn durch Gespräche und Exerzitien wieder zum Glauben zu bringen. Nichts hilft. Aus der Gemeinde kommen einige zu dem Schluss: Wir brauchen einen Pfarrer, ob er an Gott glaubt oder nicht – er war doch kein schlechter Mensch. Pfarrer Hausner hatte seinen Glauben verloren.
Der Roman ist amüsant und erschütternd zugleich. Er macht nachdenklich. Er stellt die Frage: Was glauben wir überhaupt? Warum sind wir zusammen? Den Glauben verlieren. So leicht ist es nicht mit dem Ostern feiern. Wenn wir in die Evangelien der Ostertage hineinhören, stellen wir fest: da ist viel Unglauben und Misstrauen. Die Frauen erschrecken. Die Apostel halten die Botschaft von der Auferstehung für ein Geschwätz.
Bei Petrus stellt sich Verwunderung ein und er geht zur Tagesordnung über. Thomas zweifelt. Die Emmausjünger sind mit Blindheit geschlagen. Glauben und Vertrauen haben sie verloren, vielleicht schon bisweilen zu seinen Lebzeiten, spätestens aber auf Golgotha. Und wir? Wie steht es um meinen Glauben, mein Vertrauen? Geht uns nicht auch wenigstens zeitweise der Glaube verlustig? Durch Krankheit? Durch einen Schicksalsschlag? Durch die Zeit - weil es sich auch ohne Gott und seine Verheißungen gut leben lässt?
Die Frauen in den Osterberichten scheuen keine Mühen. Sie tun alles Erdenkliche, was noch getan werden kann. Aber was können sie tun? Mit Balsam den Geruch der Verwesung bannen und die äußere Gestalt eines Menschen konservieren, so, als sei er noch da. Alles ist pietätvoll, aber es bleibt Mumiendienst. Der Engel setzt sie auf die Spur: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr sucht Jesus am falschen Ort. Osterglaube ist das nicht, was sie tun, das ist Totenverehrung. Wo Liebe mit im Spiel ist, wird der Tod in seine Grenzen verwiesen. Das sehen wir an dem Jünger, den Jesus liebte. Er ahnt, der Tod kann nicht das letzte Wort haben. Das sehen wir an Maria von Magdala. Liebe besiegt den Tod.
Wir Menschen können Jesus nicht lebendig machen und lebendig halten. Ist die Krise der Kirche in unserem Land nicht eine Glaubenskrise? Eine Vertrauenskrise? Was tun wir nicht alles? Wir setzen mehr auf unser Können und Vermögen als auf Gottes Macht und Weisheit. Jesus lebt nicht von seiner Jünger Gnade. Er lebt aus der Kraft Gottes. Wir singen es oft zu Ostern und in der Osterzeit: „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (GL 329). Es gibt Tage, die haben wir gemacht: den 1. Mai, den Muttertag, den Vatertag, den nationalen Gedenktag. Wir machen uns einen guten Tag. Wer sich darauf festgelegt hat, dass nichts anderes geschehen kann als das, was der Mensch aus sich vermag, der geht Ostern leer aus. Wir vermögen viel, aber wir können nicht alles machen.
Wirklich Ostern feiern kann nur der, der mit Gott und seiner Tat rechnet. Alle Macht liegt bei Gott. Wenn er die Macht über den Tod hat, hat er auch die Macht über die vielen alltäglichen kleinen Todesfälle meines Lebens. Ohne den Glauben an die Macht Gottes ist alles hier ein Dienst wie der der Frauen am Grab. Sie und auch die Jünger hatten den Glauben verloren. Im Erschrecken und Erstaunen finden sie zum Glauben an Gottes Macht zurück. Darum feiern wir Ostern eine Woche lang, ja 50 Tage, damit das Vertrauen in Gott neu stark wird an jedem Tag, an allen Tagen, in unserem Alltag: Ostern – das ist der Tag – jeder Tag, den Gott gemacht. Amen.