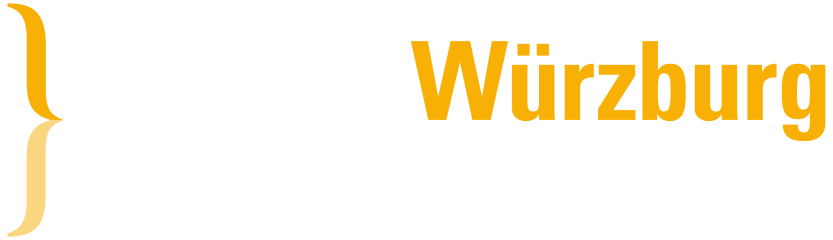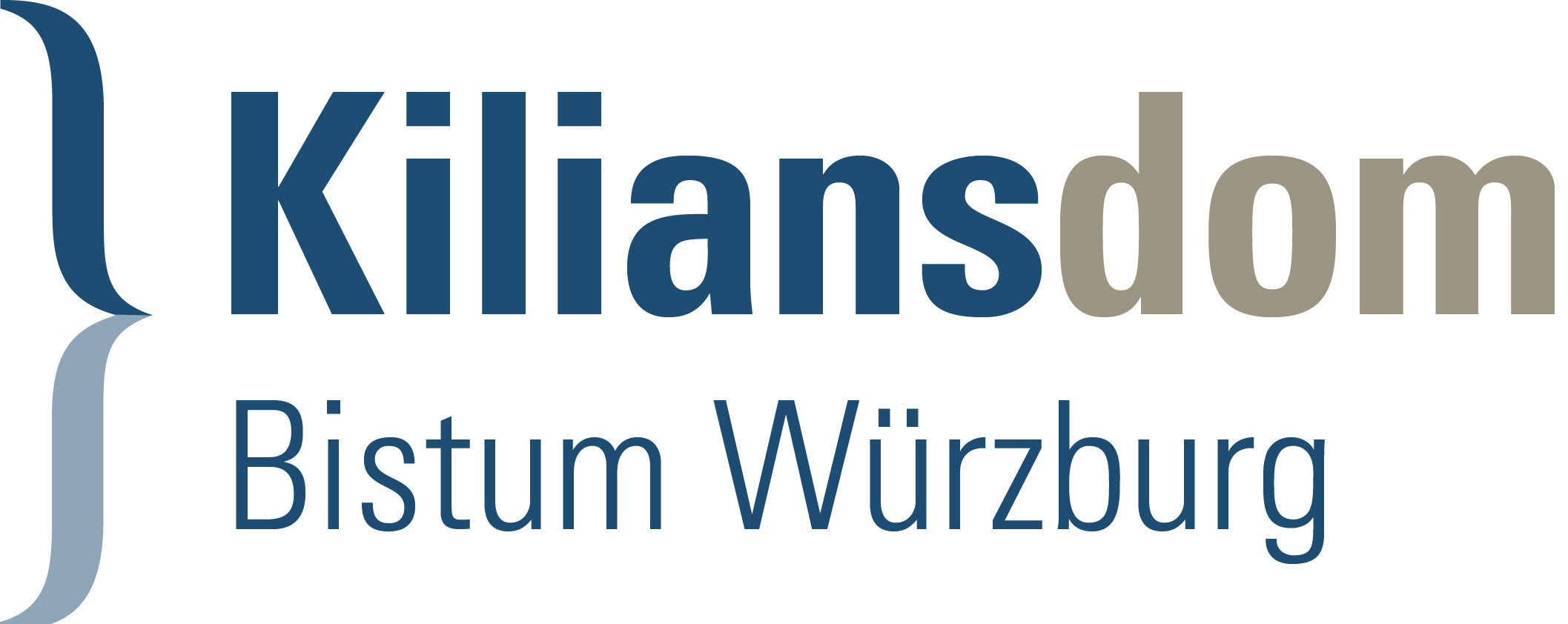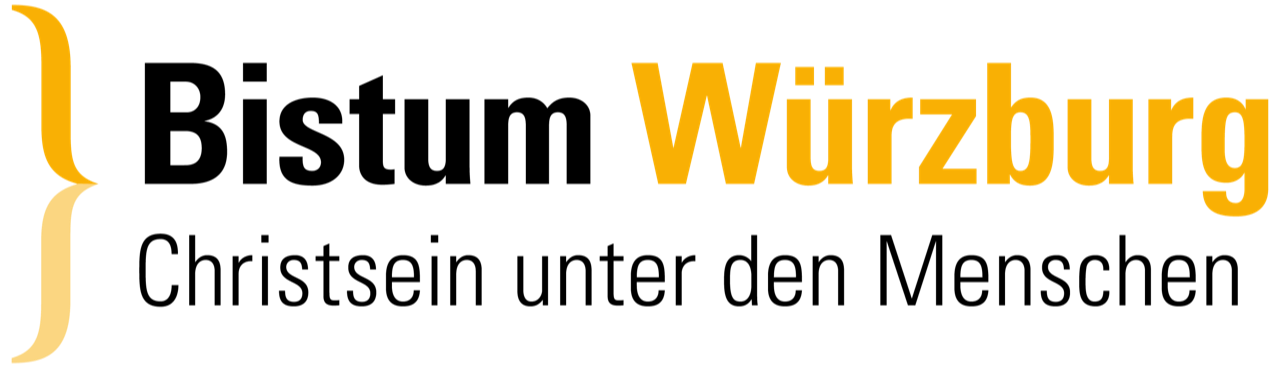Liebe Schwestern und Brüder,
heute sind es 80 Jahre seit in den Abendstunden des 16. März 1945 ein Inferno über Würzburg hereinbrach.
Heute Abend werden von 21.20 bis 21.40 Uhr alle Kirchenglocken Würzburgs erklingen, um an die Zeit des Bombenangriffs zu erinnern und mahnend in die Nacht des 16. März 2025 hineinrufen: „Nie wieder Krieg!“
Hier im Dom, dort wo heute die Kapelle mit dem Nagelkreuz und der schmerzhaften Muttergottes steht, wurden an den Tagen nach der Zerstörung unzählige Leichen abgelegt und von ihren Angehörigen identifiziert, bevor sie auf dem Hauptfriedhof in einem Massengrab beigesetzt wurden. Es ist gut und wichtig, dass wir hier im Dom vor der Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof der Opfer des 16. März 1945 gedenken.
Die mahnende Erinnerung an das, was vor 80 Jahren über diese Stadt hereinbrach, rüttelt uns wach. Sie macht uns bewusst, welches höchste Gut der Frieden ist. Gleichzeitig fragen wir uns voller Staunen, welcher unermesslichen Anstrengung es über Jahrzehnte bedurfte, um die leiblichen und seelischen Wunden der Überlebenden zu lindern und diese Stadt wieder aufzubauen.
Allein wenn wir jetzt in diesen Dom hineinblicken, müssen wir uns bewusst machen, dass es ganze 22 Jahre dauerte, bis im Jahr 1967 der Dom wieder eröffnet werden konnte. Nicht ohne Grund hatte Bischof Julius Döpfner das wegweisende Wort geprägt: „Wohnungsbau ist Dombau!“ Deswegen gründete er im Jahr 1949 das Sankt Bruno-Werk als Wohnungsgenossenschaft. So blieb das „Grab am Main“, wie Würzburg nach dem 16. März 1945 genannt wurde, kein Grab. Es erstand zu neuem Leben - ein Wunder, das sich Bahn brach und den Menschen nach dem Inferno des 2. Weltkriegs neue Hoffnung gab.
„Wer die Vergangenheit nicht kennt,
kann die Gegenwart nicht verstehen
und die Zukunft nicht gestalten.“
Dieses eindringliche Wort sprach Bundeskanzler Helmut Kohl am 1. Juni 1995 in seiner Rede über den Beitrag der deutschen Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau in Deutschland und zum Frieden in Europa. Dieses Wort gilt auch für die Männer und Frauen, die Würzburg nach der Tragödie des 16. März wieder aufgebaut haben. Unzweideutig stellte der Kanzler der Einheit im Bundestag klar, dass „die erste Ursache jener Tragödie im 30. Januar 1933 zu suchen ist.“ – Ja, das gilt in gleicher Weise für uns in Würzburg: Es gilt, die Erinnerung auch daran wachzuhalten, um die Gegenwart besser zu verstehen und die Zukunft konsequent zu gestalten.
Liebe Schwestern und Brüder,
wenn wir heute am zweiten Fastensonntag in den biblischen Lesungen drei großen Gestalten des Alten und Neuen Testaments begegnet sind, lade ich Sie ein, noch einmal ganz neu und anders – eben mit dem Blick des Glaubens - auf das Zueinander von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schauen.
Wie meine ich das? Die Liturgie des zweiten Fastensonntags führt uns hinein in die Begegnung mit Abraham, Paulus und Jesus Christus. Ihre Botschaft an uns heute steht für mich in einer gewissen Spannung zum bekannten Zitat Helmut Kohls.
Ihr Wort an uns heute hieße vermutlich eher so:
„Wer die Zukunft nicht kennt,
kann die Vergangenheit nicht verstehen
und die Gegenwart nicht gestalten.“
Ja, Sie haben richtig gehört:
„Nur wer die Zukunft nicht kennt,
kann die Vergangenheit verstehen
und die Gegenwart gestalten.“
Eben haben wir im Evangelium gehört, wie Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite nimmt und sie auf einen hohen Berg führt. Dort wird der Herr im strahlendem Licht verklärt. Jesus schenkt seinem engsten Jüngerkreis einen klaren Blick in die Zukunft. Im Gespräch mit Mose und Elija erweist er sich selbst als der von ihnen erhoffte Messias. So stärkt er seine Jünger für den Weg nach Jerusalem, damit sie am Karfreitag die Tragödie des Kreuzes aushalten können. Offensichtlich ist Jesus klar: Nur aus der Zukunft der Auferstehung kann Licht auf seinen Tod am Kreuz fallen. Deswegen heißt für mich seine Botschaft an uns heute:
„Nur wer die Zukunft der Auferstehung erkannt hat,
kann die Vergangenheit richtig verstehen
und die Gegenwart kraftvoll gestalten.“
Dieselbe Erfahrung darf auf seine Weise Abraham machen: Er wird von Gott aufgefordert, die Sterne am Himmel zu zählen. Diesem kinderlosen und hochbetagten Mann sagt der Herr: So zahlreich wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein! Dieses ganz und gar unglaubliche Versprechen gibt Gott tatsächlich dem Abram und schenkt ihm einen neuen Namen:
„Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham, Vater der Menge, wird dein Name sein“ (Gen 17,4-5).
Nur weil Abraham dieser Zusage Gottes ganz und gar vertraut, kann er verstehen, warum er noch im hohen Alter aufbrechen musste. So schöpft auch er seine Kraft aus der Hoffnung auf eine Zukunft, die Gott ihm verheißen hat.
Lassen Sie mich meinen dritten biblischen Zeugen aufrufen: Paulus!
Wir alle kennen seinen eindringlichen Satz, der uns heute in der zweiten Lesung neu zugesprochen wurde:
„Unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann“ (Phil 3,20-21).
Die Aufklärung nahm solche Sätze als Beweis, dass Religion einzig und allein auf den Himmel vertröstet. Stünde Paulus heute hier, würde auch er in seiner Wortgewalt entgegnen:
„Nein! Es geht mir mitnichten um eine Vertröstung auf die Zukunft, sondern: Nur wer die Zukunft kennt, kann die Vergangenheit verstehen und die Gegenwart gestalten.“
Liebe Schwestern und Brüder,
der Herr nimmt uns heute alle mit auf den Berg Tabor und schenkt uns einen Blick in die Zukunft: Diese Zukunft heißt Auferstehung! Wir alle dürfen als Pilgerinnen und Pilger der Hoffnung unterwegs sein, unser Ziel fest im Blick: Jesus Christus und seine Kraft.
Gott hat auch uns in der Taufe ein Versprechen gegeben: Er will auch uns in jedem Aufbruch begleiten – wie einst den Abraham. Auch wir können, in seiner Kraft das, was geschehen ist, richtig deuten und Konsequenzen für unser Tun ziehen.
Ich bin fest überzeugt, diese unbändige Hoffnung in den Herzen vieler Menschen hat Würzburg nach dem Inferno des 16. März 1945 wieder erstehen lassen. Ergreifen auch wir diese Hoffnung! Im Blick auf die Brandherde unserer Tage sind wir heute gefordert! Stärken wir heute unseren Glauben und beten:
„Herr, nimm auch uns zum Tabor mit, um uns dein Licht zu zeigen!
Lass unsre Hoffnung Schritt um Schritt mit dir zu Gott aufsteigen:
Du wirst auch uns verklären, Herr der Herren.“ (GL 363)
Amen.